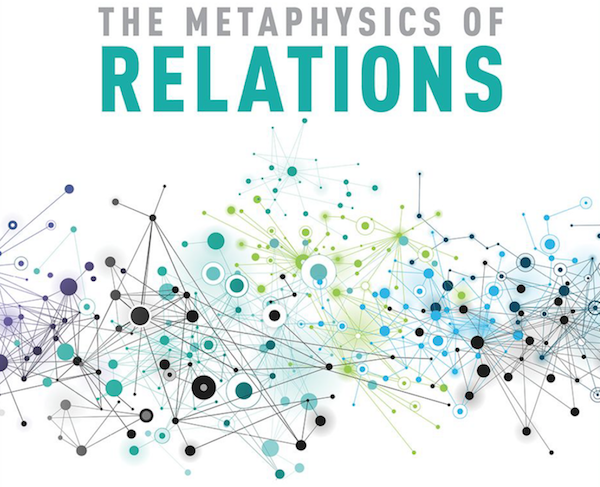Als "Zitatfetischist" kann ich es nicht lassen:
"Hier sind vier metaphysische Fragen, die zu Beziehungen gestellt werden müssen. Was sollen sie sein? Was sollen sie tun? Wie sollen sie es tun? Gibt es überhaupt welche?" [Google Translate]
(MacBride, Fraser. "Relations: Existence and Nature." In The Routledge Handbook of Properties, edited by A. R. J. Fisher & Anna-Sofia Maurin, 82-91. Abingdon: Routledge, 2024. p. 82)
"Metaphysiker (in ihrer Sprache gesprochen) sind sich uneinig darüber, was genau als Relation gilt, und auch darüber, ob es überhaupt Relationen gibt. Aber in Folgendem herrscht Einigkeit: Wenn es solche Entitäten gibt, dann gibt es, abgesehen von Einschränkungen, Fälle, in denen Dinge aufeinander bezogen sind, weil es etwas anderes gibt, eine Relation, die die Rolle des Vermittelns oder Dazwischenstehens erfüllt. So soll eine Relation im Allgemeinen Relationiertheit erklären. Denn es besteht eine Lücke zwischen der Behauptung (a), dass einige Dinge relationiert sind, und der Behauptung (b), dass eine Relation zwischen ihnen besteht, sodass (b) ein Kandidat für die Erklärung von (a) ist. Wir haben Grund zu der Annahme, dass es solche Entitäten tatsächlich gibt, wenn die beste Erklärung für das Relationiertsein von Dingen darin besteht, dass es eine Relation gibt, die für ihr Relationiertsein verantwortlich ist. Das bedeutet nicht, dass alle Fälle von Relationiertheit durch Relationen erklärt werden, noch dass es für jeden Fall von Relationiertheit, der durch Relationen erklärt wird, eine eindeutige Relation gibt." [Google Translate mit Änderungen meinerseits]
(MacBride, Fraser. "Relations: Existence and Nature." In The Routledge Handbook of Properties, edited by A. R. J. Fisher & Anna-Sofia Maurin, 82-91. Abingdon: Routledge, 2024. p. 84)
"Relationen sind dafür zuständig, Relationiertheit zu erklären, indem sie zwischen relationierten Dingen bestehen. Wenn wir nun überhaupt etwas wissen, dann, dass es relationierte [aufeinander bezogene, sich zueinander verhaltende] Dinge gibt. Schauen Sie sich einfach um und sehen Sie. Tatsächlich müssen wir uns nicht einmal umsehen, um uns dessen sicher zu sein, denn die Art von Bewusstsein, die für uns typisch ist, besteht aus aufeinanderfolgenden, sich gegenseitig durchdringenden mentalen Episoden. Wenn also der Glaube an Relationen die beste Erklärung ist, die wir uns für das Relationiertsein solcher Dinge ausdenken können – vorausgesetzt, dass die beste Erklärung erklärungsstark genug ist, sodass sie es verdient, ernst genommen zu werden, und nicht nur die beste von einem schlechten Haufen [von Erklärungen] ist – dann haben wir einen guten Grund anzunehmen, dass Relationen existieren." [Google Translate mit Änderungen meinerseits]
(MacBride, Fraser. "Relations: Existence and Nature." In The Routledge Handbook of Properties, edited by A. R. J. Fisher & Anna-Sofia Maurin, 82-91. Abingdon: Routledge, 2024. pp. 86-7)
"Unterscheiden Sie die Ontologie einer Theorie T, also das, was T als existierend postuliert oder impliziert, von der Ideologie von T, also den sprachlichen Ressourcen, auf die sich T stützt, um zu beschreiben, was sie als existierend postuliert oder impliziert, Ressourcen, die zumindest aus der Perspektive von T nicht analysierbar sind. Dann muss man mit der folgenden nominalistischen Antwort rechnen: Die Ideologie der Relationiertheit, die ein außerordentlich weit verbreitetes Merkmal der Alltagssprache ist, ja sogar wesentlich für den Ausdruck der in dieser Sprache verkörperten Weltsicht, hat keine entsprechende Ontologie." [Google Translate mit Änderungen meinerseits]
(MacBride, Fraser. "Relations: Existence and Nature." In The Routledge Handbook of Properties, edited by A. R. J. Fisher & Anna-Sofia Maurin, 82-91. Abingdon: Routledge, 2024. p. 88)
"Hier ist die gute Nachricht. Es ist noch völlig offen, welche Erklärung von Beziehungen die beste ist, die wir haben. Hier ist die schlechte Nachricht. Das liegt daran, dass wir kein vereinbartes Verfahren haben, um Abwägungen zwischen Ontologie und Ideologie zu treffen." [Google Translate mit Änderungen meinerseits]
(MacBride, Fraser. "Relations: Existence and Nature." In The Routledge Handbook of Properties, edited by A. R. J. Fisher & Anna-Sofia Maurin, 82-91. Abingdon: Routledge, 2024. p. 90)
"Die Rede von Relationen ist sowohl im Alltag als auch in den Wissenschaften unverzichtbar. Doch was genau sind Relationen? Was macht relationale Urteile wahr, wenn sie wahr sind? Relationale Urteile streben nach Objektivität. Relationale Urteile erheben den Anspruch, buchstäblich wahr zu sein. Relationen und Arten von Relationen gibt es in Hülle und Fülle. Warum sind sich Philosophen dann so uneinig über das Wesen von Relationen? Warum finden so viele Philosophen Relationen rätselhaft? Warum gehen manche so weit, die Realität von Relationen anzuzweifeln? Ist das einfach nur Philosophentum, das Gründe findet, Dinge in Frage zu stellen, die kein vernünftiger Mensch auch nur im Traum in Frage stellen würde? Warum müssen Philosophen etwas Einfaches nehmen und es in etwas Schwieriges verwandeln?
Mit etwas Glück beantworten sich diese Fragen von selbst, sobald man ernsthaft über das Wesen von Relationen nachdenkt. Dazu ist ein Ausflug in die Metaphysik erforderlich, insbesondere in jenen Zweig der Metaphysik, den Philosophen Ontologie nennen. Die Ontologie befasst sich mit dem, was es gibt, nicht im Sinne der Zusammenstellung von Listen einzelner Entitäten, so wie man den Inhalt seines Medizinschranks auflisten könnte, sondern im Sinne der Herausarbeitung der allgemeinsten Kategorien, unter die bestimmte Entitäten fallen. Ein Cricketball ist ein Ding, ein Objekt. Im Gegensatz dazu sind die Kugelform und die rote Farbe des Cricketballs keine Objekte, sondern Eigenschaften eines Objekts. Hier gibt es zwei ontologische Kategorien: Objekte und Eigenschaften. Gibt es noch weitere?
… Bilden Relationen eine eigenständige Seinskategorie oder werden sie in andere Kategorien assimiliert? Sind Relationen beispielsweise eine Art von Eigenschaft? Zugegeben, wir sprechen frei von Relationen, aber gibt es Relationen wirklich? Sind Relationen Etwas(se)? Sind Relationen eigenständige Entitäten? Meinungsverschiedenheiten sind unvermeidlich, aber vielleicht nicht unlösbar." [Google Translate mit Änderungen meinerseits]
(Heil, John. Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. p. 1)
Zitate von Relationsbefürwortern:
"Es gibt gewichtige Gründe, die Möglichkeit für Relationen oder relationsähnliche Entitäten in einem ontologischen Kategoriensystem offenzuhalten. Der erste Grund ist, dass eine relationale Theorie des Raums oder der Raumzeit unter den konkurrierenden Ansichten nach wie vor eine wichtige Option darstellt. Da die relativen Orte von Objekten in Bezug auf ihre Existenz und monadischen Eigenschaften kontingent sind, besteht eine Möglichkeit darin, anzunehmen, dass die Raumzeit (oder der Raum) durch Relationen oder relationenähnliche Entitäten konstituiert wird, die die Raumbesetzer verbinden.
Zweitens argumentieren neuere Wissenschaftsmetaphysiker, dass die aktuellen physikalischen Theorien uns unabhängige Gründe für die Postulierung von Relationen oder relationsähnlichen Entitäten liefern. Die aktuelle Quantenphysik führt verschränkte Zustände von Zwei- oder Mehrteilchensystemen ein, die ernsthafte Kandidaten für fundamentale Relationen zwischen Teilchen sind. So argumentiert Paul Teller, dass verschränkte Spinzustände zweier überlagerter Elektronen am besten als Relationen betrachtet werden können, die nicht auf der räumlich-zeitlichen Anordnung und den monadischen Eigenschaften dieser Teilchen beruhen. Jeremy Butterfield argumentiert, dass sowohl die klassische als auch die relativistische Mechanik fundamentale Größen einführen. die nicht als intrinsische Eigenschaften von Raum-Zeit-Punkten betrachtet werden sollten. Möglicherweise müssen wir Relationen einführen, um einige dieser Größen zu erklären. Schließlich führen Quantenfeldtheorien Wechselwirkungen von Teilchen ein, die durch virtuelle Teilchen vermittelt werden, die ebenfalls als relationale Entitäten betrachtet werden könnten.
Es gibt vielleicht keinen einzelnen Grund, der zeigen könnte, dass der Eliminativismus in Bezug auf Relationen falsch ist. Unabhängige Überlegungen legen jedoch nahe, dass es eine vernünftige Strategie ist, die Existenz von Relationen oder relationsnähnlichen Entitäten in einem adäquaten ontologischen Kategoriensystem zuzulassen." [Google Translate mit Änderungen meinerseits]
(Keinänen, Markku. "Lowe's Eliminativism about Relations." In E. J. Lowe and Ontology, ed. by Miroslaw Szatkowski, 105-122. New York: Routledge, 2022. p. 116)
"Der angebliche Hauptgrund für die Ablehnung von Relationen ist, dass sie nirgends existieren können. Es ist klar, dass sie nicht in einem der Relata sind, ohne in den anderen zu sein. Auch sind sie nicht in jedem von ihnen, getrennt betrachtet. Sie sind, so heißt es, zwischen den Relata und nicht in ihnen. Dann fragt man: Gibt es etwas, in dem sie sein können? Und wenn diese Frage verneint wird, kommt man zu dem Schluss, dass sie unmöglich sind.
[Fußnote 1: Dies ist die Argumentationslinie von Lotze und im Wesentlichen auch von Leibniz. Die Einwände von Herrn Bradley sind anders und führen zu einer anderen Schlussfolgerung. Er versucht nicht, wie Leibniz und Lotze, Relationen auf Qualitäten zu reduzieren, sondern lehnt Qualitäten und Relationen gleichermaßen ab.]
Diese Annahme ist jedoch ungültig, weil sie voraussetzt, dass eine Relation unmöglich ist, es sei denn, es lässt sich etwas finden, in dem sie wie eine Qualität ist oder innewohnt [inhäriert]. Als Test für die Möglichkeit von Relationen wird die Frage herangezogen, ob sie sich genau wie Qualitäten verhalten können; und wenn man zugibt, dass dies nicht der Fall sein kann, so kommt man zu dem Schluss, dass Relationen unmöglich sind, und dass in einer wahren Sicht der Realität Relationsurteile durch Qualitätsurteile ersetzt würden.
Es gibt jedoch keine Rechtfertigung für die Annahme, dass eine Relation unmöglich ist, wenn sie nicht wie eine Qualität in etwas innewohnen [inhärieren] kann. Auf die Frage „Worin befindet sich eine Relation?“ können wir mit Fug und Recht antworten, dass sie nicht in irgendetwas befindet, sondern zwischen zwei oder mehr Dingen, oder zwischen einem Ding und sich selbst, und dass die Auffassung von „zwischen“ ebenso grundlegend ist wie die Auffassung von „in“ und ebenso viel Anspruch darauf hat, als gültig angesehen zu werden. Beide sind grundegend, keine enthält einen Widerspruch, und die Rechtfertigung unserer Verwendung beider liegt darin, dass es unmöglich ist, irgendetwas zu behaupten, ohne die Realität sowohl von Qualitäten als auch von Relationen zu behaupten oder zu implizieren. Dass dies sowohl hinsichtlich Qualitäten als auch hinsichtlich Relationen unmöglich ist, haben wir bereits gesehen. Im uns unmittelbar betreffenden Fall, den Relationen von Substanzen zu Substanzen, muss die Substanz, da sie existiert, mit sich selbst identisch sein; und, wie bereits erwähnt, da mehr als eine Substanz existiert, müssen sie einander ähneln und sich voneinander unterscheiden.
Und es ist zu beachten, dass die Aussagen, die diese Relationen behaupten, absolut wahr sein werden. Es ist nicht nur so, dass wir der Wahrheit näher kommen, wenn wir sie behaupten, anstatt sie zu leugnen. Es kann keine Substanz geben, wenn es nicht absolut wahr ist, dass sie mit sich selbst identisch ist, und es kann nicht mehr als eine Substanz geben, wenn es nicht absolut wahr ist, dass sie ähnlich und verschieden sind.
Der Begriff der Relation muss daher als gültig für das Existierende akzeptiert werden."
[Google Translate mit Änderungen meinerseits]
(McTaggart, John M. E. The Nature of Existence. Vol 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1921. pp. 81-2)
"Was ich vorschlage, lässt sich in einem Slogan zusammenfassen: Eine Beziehung ‚überbrückt den ontologischen Raum‘." [Google Translate]
(Mertz, D. W. On the Elements of Ontology: Attribute Instances and Structure. Berlin: De Gruyter, 2016. p. 116)
"Ohne eine Kategorie von Entitäten, deren Natur darin besteht, ‚ontologische Distanz‘ nach außen zu überbrücken und sich mit Dingen ‚zusammenzuhalten‘, mit denen sie kein zusammensetzendes Sein teilen, d. h. ohne ontogliale Entitäten (griechisch: ‚Klebstoff des Seins‘), würden diskrete Entitäten jeweils absolut voneinander isoliert bleiben. Jede Entität würde als radikal abgetrenntes Atom existieren, eine extreme ‚Monade‘, völlig frei von Verbindungen mit anderen – physisch, kognitiv (z. B. Assoziationen) usw. –; und aufgrund dieser völligen gegenseitigen Isolation hätte kein Geist (angenommen, per impossibile, dass es Geiste gibt, die notwendigerweise dynamisch funktionierende Strukturen sind) zu einer solchen Entität epistemischen Zugang, da dies reale epistemische Beziehungen erfordern würde, die den Wissenden und das gewusste Andere verbinden. Letzteres weist, so meine ich, darauf hin, dass polyadische Beziehungen als Kategorie intuitiv offensichtliche Beispiele für ‚nach außen gerichtete verbindende und auswählende‘ Entitäten sind, eine ontische Rolle, die, wie wir klären werden, alle Attribute haben. Auch ein vielteiliges Ganzes als etwas intrinsisch bestimmte Elemente Verbindendes erfordert, dass die „auswählenden Verknüpfungen“ ebenso wesentlich/intrinsisch und Teile des Ganzen sind wie die vereinigten Elemente, d. h., dass sie selbst Elemente sind. Dies zu leugnen, bedeutet entweder, interne Vereiniger mit externen Wirkursachen zu verwechseln, die sie bewirken – wobei letztere entfernte Ursachen der Ganzheiten sind, die unmittelbar von den konstituierenden Vereinigern bewirkt werden –, oder die Wirkung der vereinigenden Kraft – des Ganzen – mit einer Ursache dieser Kraft zu verwechseln, was beispielsweise zu dem Fehler führt, Mengen oder Summen als Ursachen der Vereinigung ihrer Elemente zu betrachten." [Google Translate mit Änderungen meinerseits]
(Mertz, D. W. On the Elements of Ontology: Attribute Instances and Structure. Berlin: De Gruyter, 2016. p. 188)
"Relationen sind die conditio sine qua non eines pluralistischen Universums, der Verbundenheit, Struktur, Ordnung und Form. Um einen Begriff zu prägen: Relationen sind ontoglial (griechisch für „der Klebstoff des Seins“)."
(Mertz, D. W. Moderate Realism and Its Logic. New Haven: Yale University Press, 1996. p. 25)
Zitate von Relationsgegnern:
"Relationen lassen sich in einer Ontologie von Substanzen und Attributen nur schwer unterbringen. Relationen scheinen keine Substanzen zu sein. Könnten sie etwa Attribute sein? Attribute sind jedoch in bestimmten Substanzen verankert, und es ist unklar, wie ein einzelnes Attribut mit unterschiedlichen Substanzen (seinen Relata) verbunden sein könnte. Der Gedanke, dass Relationen ‚zwischen‘ Substanzen bestehen, droht Relationen in Substanzen zu verwandeln und erscheint daher wenig erfolgversprechend. Könnten wir dann auf Relationen verzichten? Das erscheint verrückt. Relationale Prädikationen sind offenbar unverzichtbar. Relationale Prädikationen lassen sich nicht in Prädikationen übersetzen oder anderweitig auflösen, die Relationen nicht erwähnen. Versuche, Relationen durch monadische ‚relationale Eigenschaften‘ zu ersetzen, riechen nach Sophisterei; die Rede von relationalen Eigenschaften ist offensichtlich nichts weiter als eine indirekte Art, von Relationen zu sprechen." [Google Translate]
(Heil, John. "Universals in a World of Particulars." In The Problem of Universals in Contemporary Philosophy, edited by Gabriele Galluzzo and Michael J. Loux, 114-132. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. p. 130)
"Relationen sind, so betrachtet, weder Fisch noch Fleisch, weder Substanzen noch Modi. Man kann Relationen als sui generis betrachten, als fundamentale Entitäten besonderer Art, die zur Erklärung unserer besten Theorien erforderlich sind, oder man kann versuchen, Urteile über Relationen, relationales Denken und Sprechen so zu vereinen, dass Relationen nicht ontologisch fundamental werden.
Ich glaube, dieses Denkmuster taucht in den Epochen zwischen Aristoteles und Kant immer wieder auf. Das Ergebnis ist, dass Philosophen Relationen insgesamt als ontologisch problematisch betrachteten." [Google Translate]
(Heil, John. The Universe As We Find It. Oxford: Oxford University Press, 2012. pp. 141-2)
"Relationen hängen offensichtlich metaphysisch von ihren Relata ab, können also keine Substanzen sein. Es ist jedoch schwer zu erkennen, wie eine Relation ‚zwischen‘ Substanzen ein Modus oder Akzidens sein könnte. Wir scheinen gezwungen zu sein, uns zwischen der Gründung von Relationen auf nicht-relationalen Merkmalen von Relata oder ihrer Hinzufügung zur grundlegenden Ontologie zu entscheiden. Aber wie würde diese zweite Option funktionieren? Was genau würden wir uns vorstellen, wenn wir uns Relationen ‚da draußen‘ vorstellen, die ihre Relata verbinden? Die Seltsamkeit dieser Möglichkeit wird Ihnen nicht auffallen, wenn Sie sich damit zufriedengeben, eine Entität zu postulieren, die auf jedes Prädikat antwortet. Aber das bedeutet nur eine Rückkehr zu der Art sprachlicher Metaphysik, der wir inzwischen entwachsen sein sollten." [Google Translate]
(Heil, John. The Universe As We Find It. Oxford: Oxford University Press, 2012. p. 149)
"Ich werde auf einem Universum mit nicht-relationalen Wahrmachern für irreduzible relationale Wahrheiten bestehen.
Wenn Sie anderer Meinung sind, wenn Sie Beziehungen wünschen, dann liegt der Ball bei Ihnen. Es reicht nicht aus, einfach die Existenz von Beziehungen neben Substanzen und Eigenschaften zu verkünden. Es liegt an Ihnen, eine greifbare ontologische Geschichte zu liefern. Von meinem Standpunkt aus sind die Aussichten nicht vielversprechend." [Google Translate]
(Heil, John. The Universe As We Find It. Oxford: Oxford University Press, 2012. p. 150)
"[Eine Relation] besteht zwischen Entitäten und ist ihnen nicht inhärent. Wir können uns jedoch fragen, ob diese brückenartige Existenz zwischen Entitäten letztendlich eine denkbare Seinsweise ist und ob es im Universum wirklich einen Platz für Relationen gibt, wenn sie sich nicht mit dem aristotelischen Status der Aussagbarkeit [Prädizierbarkeit] von einer einzelnen konkreten Sache zufriedengeben" [Google Translate mit Änderungen meinerseits]
(Findlay, J. N. "Relational Properties." Australasian Journal of Psychology and Philosophy 14/3 (1936): 176–190. p. 180)